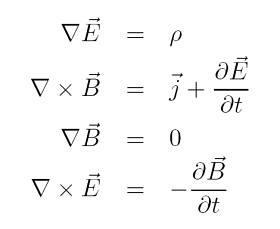Hi Leute, als letzen Abschluss für die Prüfungsvorbereitung hier mal alle meine Antworten auf die Fragen aus „Beispiele für schriftliche Fragen“ (siehe Anhang:)
1) Näherungen- statisch, adiabatisch, harmonisch
_1) Die adiabatische Näherung und die statistische Näherung sind mathematische Verfahren zur Trennung der Gitterbeiträge von den Beiträgen der Elektronen. Die meisten Eigenschaften eines Festkörpers lassen sich gliedern in Folgen der Gitterww. und jener der Elektronenwechselwirkung. Die e-Gitter Wechselwirkung kann dabei, falls nötig, wieder als kleine Störung in die Theorie einfließen. Um jedoch z.B. Supraleiter zu verstehen ist diese Wechselwirkung wichtig (Cooperpaare). Die Rechtfertigung für diese Vorgehensweise findet sich in der stark unterschiedlichen Geschwindigkeit zwischen den Atomen (Gitter) und den Elektronen. Während die Atome sich ein kleines Stück bewegen, folgen ihnen die Elektronen in einer Anzahl von quasistatischen Prozessen. Bereits kurz nach der Auslenkung der Atome befinden sich die Elektronen somit wieder im Grundzustand. Daher wird in weiterer folge bei jenen Näherungen nur die Auslenkung der Atome und die mittlere Elektronenverteilung bedrachtet.
Die statistischen Näherung stellt eine Erweiterung der adiabatischen Näherung dar. Hierbei wird die mittlere Gleichgewichtslage der Atome als Zentrum für die Elektronenverteilung betrachtet, bei der adiabatischen Näherung die momentane Lage der Atome. Ein großer Vorteil der stat. Näherung: Die Periodizität des Gitters kann in die Rechnung einfließen und so bleibt viel Rechenarbeit erspart (Reduktion auf die 1te Brillouinzone).
Bei beiden Näherungen wird zwischen quasistatischen (lokalisierte) Elektronen und quasifreien Elektronen (Valenzelektronen, so weit entfernt vom Atom dass sie sich frei bewegen können) unterschieden.
Findet nun eine Taylorentwicklung der potentiellen Energie um die Gleichgewichtslage statt und diese nach dem zweiten Term abgebrochen, so spricht man von einer harmonischen Näherung, da das Potential jenem eines harmonischen Oszillators ähnelt (Siehe Phononenskriptum, Seiten 4-6). Für die Berechnung der Wärmeleitfähigkeit im Festkörper ist dies jedoch nicht ausreichen, da man zur korrekten Beschreibung Umklappprozesse benötigt, welche erst durch die anharmonischen Terme im Potential entstehen können.
2) Die reine Betrachtung der Gitterschwingungen kann zwar die Wechselwirkung mit elektromagnetischen Welle gut beschreiben, hat jedoch Problem mit Isolatoren, Supraleitern, der Wärmekapazität, der Wärmeleitung, und der Schallübertragung. Das dynamische Verhalten lässt sich dann im Festkörper als Folge der harmonischen Näherung beschreiben. Bsp.: Atomare Ketten ( 2)+ 3))
_
2) monoatomare lineare Kette: Schwingungsmoden, Randbedingungen, Amplitudenverhältnis, Dispersionsrelation, Bedeutung der Brillouinzonengrenzen:
1) Skizze des Problems, einer monoatomaren Kette, Betrachtung der Glieder n-1, n, n+1;
2) physikalische Gesetze: Federgesetz vs. Newton: F=-Cx, wobei x die Auslenkung ist und „C“ die Federkonstante. Und F=ma=md²/dt² (x)
3) Lösungsansatz finden: fortschreitende, ebene Wellen: x_n=exp(i[kna-omegat]) mit der Gitterkonstanten „a“
4) Randbedingungen: Born von Karman (Kette ohne Anfang und Ende): u_N+1=u_1; u_N=u_0 mit n=1,2,…,N
5) Eingesetzt in die Gleichung aus 2) folgt somit: momega²=-C( exp(ika)- exp(-ika)- 2)=2C*(1-cos(ka))=/cos(ka)= 1-sin²(ka/2)/=4Csin²(ka/2)
Und somit die Amplitude: Wurzel (4C/m)
Und somit folgt für die Dispersionsrelation: omega=2Wurzel(C/M) * I sin(ka/2) I, wobei Dispersion für omega=omega(k_vektor) steht…
6) Brillouinzonen: k=-pi/2 bzw. +pi/2, hier liegt die erste Brillouinzone per Definition. Die Gruppengeschwindigkeit „v_g=d/dk (omega)“ verschwindet am Zonenrand dacos (a* pi/2)=cos(-api/2)=0 ist. Daher spricht man hier auch von stehenden Wellen.
Da die Gitterpunkt mit dem regelmäßigen Abstand a angeordnet sind, führen Wellen die über die erste Brillouinezone ragen nicht zu neuen (!), physikalischen Lösungen sondern können mittels reziproken Gittervektor „G“ immer auf Lösungen in der ersten Brillouinzone zurück geführt werden.
7) Weiter können zwei Grenzfälle betrachtet werden:
große Wellenlängen (lambda_n>>1 => k_na<<1): cos (ka) ~= 1-1/2*(ka)² und somit omega= Wurzel(C/m)* (ka)
und kleine Wellenlängen (k_na>> 1)
8 ) Schwingungsmoden: 1* longitutional (Ausbreitungsvektor k und Auslenkung der Oszillationen sind para//el) bsp. Schraubenfeder, 2transversal (Oszillation senkrecht zur Ausbreitungsrichtung der Welle also k_vektorA_mplitudenvektor=0), bsp. Seil.
3+4) Kette aus zwei Atomsorten (M,m):
1) Vorgehensweise wie zuvor bei 2) mit Skizze, Federgesetz, Ansatz für ebene Wellen (Uexp(…), Vexp(…) ) und dergleichen.
Als Auslenkungen wurden u_n und v_n verwendet womit folgt: Md/dt (u_n)=C(v_n-1 - v_n - 2u_n), md/dt(v_n)=C(…-2v_n)
2) Somit folgt als Lösung für omega=C(1/M+1/m) -/+ Wurzel { (1/M+1/m)² - 4/Mm * sin²(ka/2) }
3) Verwendet man die minus- Lösung, so handelt es um den akustischen Zweig, blickt man stattdessen auf die plus- Lösung so handelt es sich um den optischen Zweig. Daher liegt der akustische Zweig auch unter dem optischen Zweig im omega/ k- Diagramm.
Und weiters noch nennenswert: Beim optischen Zweig schwingen die verschiedenen Atome gegeneinander.
4) Werden nun wieder die Grenzfälle betrachtet, so gilt für große Wellenlängen (kleines k:)
optischer Zweig: (omega)² ~= 2C(1/M+1/m)
akustischer Zweig: (omega) ~= Wurzel {2C/ (M+m)} * (ka) … siehe 2)-7)
5) Weiters noch sichtbar ist die Frequenzlücke oder auch Gap genannt: In diesem Bereich haben Kristalle keine Eigenschwingungen und elektromagnetische Wellen (z.B. Licht) kann sich nur stark gedämpft ausbreiten. Daher hat der Kristall in diesem Bereich ein hohes Reflexionsvermögen und sendet einen großen Teil des einfallenden Lichtes zurück…
6) Allgemein treten immer drei akustische Zweige auf (1long. +2 transv.). Gibt es in der primitiven Einheitszelle jedoch p-Atome, so gibt es u optische Zweige[/u] und 3 akustische Zweige. Also insgesamt p- Zweige…
5+6) Debye und Einstein: gekoppelt oder nicht
Grundideen/ Grenzfälle (hoche und tiefe Temperaturen)/ Festlegung und Bestimmung der Debyetemperatur/ Energieabhängigkeit der Zustandsdichte von Phononen D(omega)
1) Um zum Kern der Frestkörperphysik durchzudringen sollte man verstehen was den Anstoss gegeben hat. In manchen Büchern wird behauptet das die theoretische Beschreibung der Wärmekapazität hierfür ein Grundstein war. Im Grenzfall hoher Temperaturen gilt das Gesetz von Dulong- Petit, bei niederigen Temperaturen deckt sich die Lösung von Debye (T³) sehr gut mit den Experimenten. Und bei mittleren Temperaturen kann die Lösung von Einstein als Näherung verwendet werden.
2) Debye: Wurde bei der p- atomaren linearen Kette noch postuliert das es p- Schwingungen gibt, so reduziert Debye diese auf drei Schwingungen (akustische Moden). Die damit definierte Debyefrequenz ist ein Maß für die maximale Frequenz der Phononen (obere Integralgrenze!). Die Annahmen für das Debyemodell sind: N gekop+pelte Oszillatoren mit einem Frequenzspektrum (omega= cSchall * kVektor- die drei akustischen Moden werden durch eine mittlere Mode ersetzt.). Genauso wie oben kann die Dispersionsrelation über die Zustandsdichter in ner Kugel hergleitet werden und es ergibt sich das T³ Gesetz von Debye (welches nur den Einfluss von Gitterschwingungen auf die Wärmekapazität berücksichtigt und nicht jene der Elektronen [gammaT, Sommerfeld!] oder weiter Wechselwirkungen). Für den Grenzfall: „tiefe Temperaturen“ gilt: cv=betaT³, bei hohen Temperaturen: cv=3*R, also das Dulong Petit Gesetz…
3) Einstein: Die Annahmen für das Modell von Einstein sind: N- ungekoppelte Oszillatoren welche mit einer Freqeunz schwingen. Eim Gegenzug zu Debye welcher mit den akustischen Zweigen gerechnet hat, rechnete Einstein mit den optischen Zweigen.
Die Frequenz omega ist bei Einstein somit nicht mehr abhängig von kVektor…
Für hohe Temperaturen nähert sich die Lösung von Einstein jener von D.P. und passt somit. Für tiefe Temperaturen würde man mit Einsteins Lösung eine exponentielle Abnahme erwarten. Dies stimmt jedoch nicht mit den Experimenten überein, so dass hier Debye eine bessere Lösung bietet…
7+8+9) Welche Bedingungen muss das Potential erfüllen damit Umklapp Porzesse stattfinden?
Anharmonische Effekte? Den durch die Abweichung vom lineare Kraftgesetz zwischen den Gitteratomen kommt es zur Wechselwirkung der Phononen. Und nur wenn diese wechselwirken, so kann auch der reziproke Gittervektor vom Kristallgitter aufgenommen werden.- wäre meine Antwort (nach Wikipedia und Ascroft)…
Skizzieren Sie die Temperaturabhängigkeit des Gitterbeitrages zur Wärmeleitung?
_Hier würde ich für eine Aufteilung in drei Bereiche tendieren und labda gegen T zeichnen mit (wie Skizze 25.41 aus Ashcroft):
niedrige Temp. (kaum Umklappprozesse):
lambda ist prop. zu T³*Probenlänge; (mit der Annahme das die Probenlänge der mittleren freien Weglänge entspricht und der Phononendichte von Debye als T³)
\
mittlere Temp. (mittlere Besetzungszahl der Phononen):
lambda ist prop zu. exp(Debyetemp./ 2T) oder Debyetemp./T je nach Buch…
.
hohe Temp. (angeregte Phononen im Debyefrequenzbereich, viele Umklappprozesse):
lambda ist prop. zu 1/Temp.
Zudem der Zusatz das Debye von der kinetischen Gastheorie ausging (hier wird auf das Phononengas bezug genommen!) sich die Formel lambda= 1/3c_vmittlerer freier Weglänge ausborgte und Phononen statt Teilchen betrachtete. Umklappprozesse jedoch den Impuls und die Energie nicht erhalten beim Stoß und somit zum Wärmewiederstand beitragen…_
Bin mir jedoch nicht ganz sicher und würde mich um Verbesserungsvorschläge, Herleitungen, Skizzen, Beschwerden und mehr freuen… ![]()
ps.: Danke nochmals an Siahvasch für die tolle Ausarbeitung von der ich viele Teile hier einfliessen lasse…
Beispiele_fuer_schriftl_Fragen.pdf (39.5 KB)